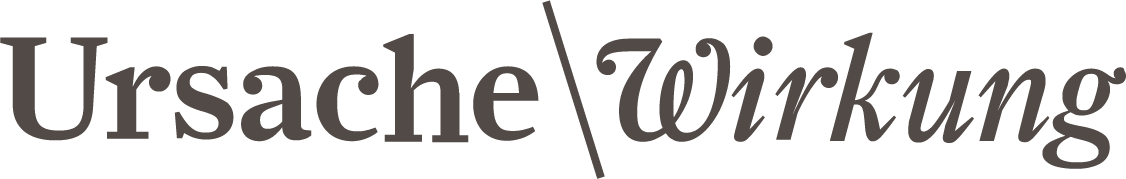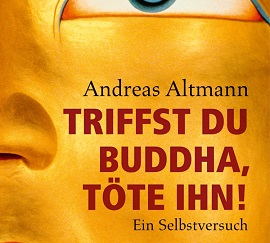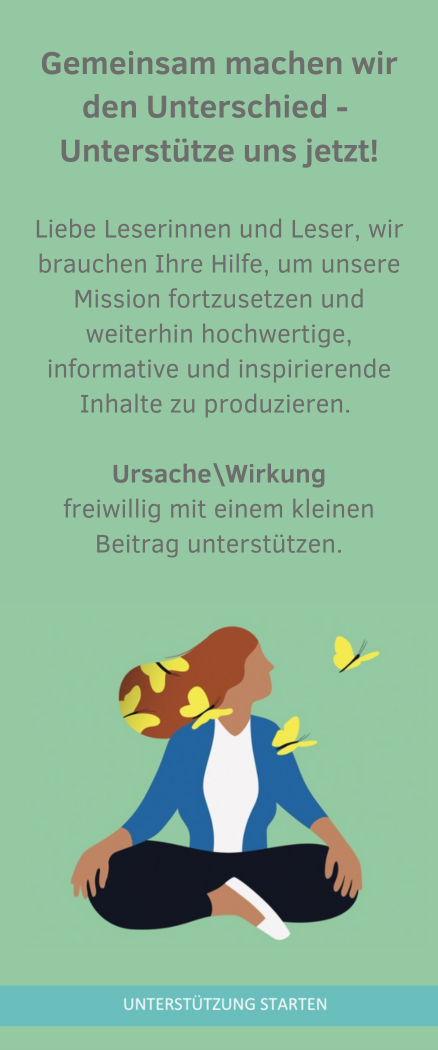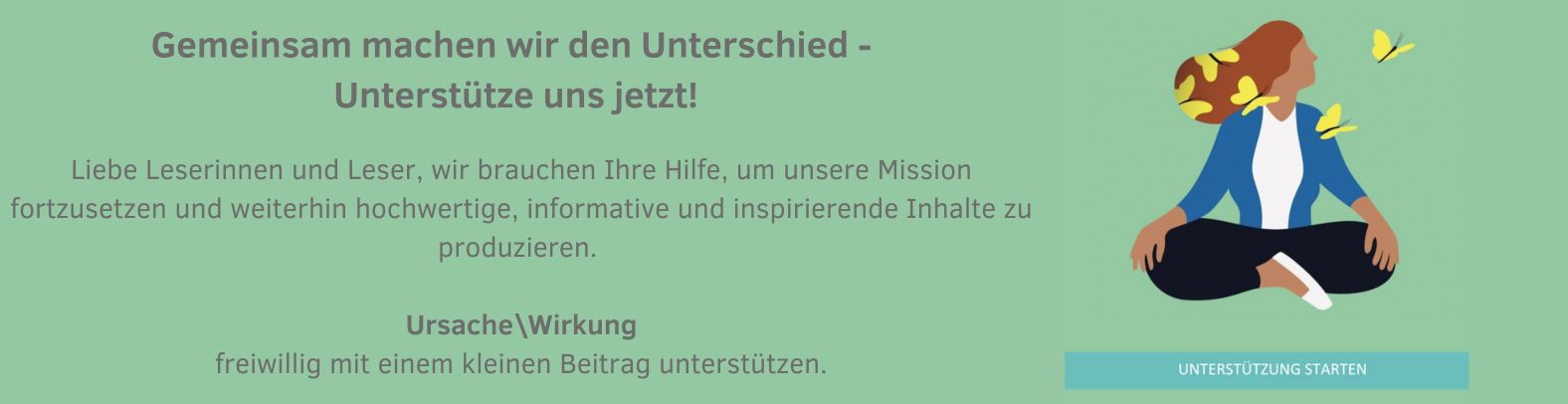Stress hat viele Auslöser. Doch was passiert im Körper, wenn Lebewesen in Alarmbereitschaft versetzt werden?
Stress ist ein Begriff, der – wenig überraschend – sehr eng mit Krieg verbunden ist. Der US-amerikanische Physiologe Walter Cannon erforschte die Hintergründe der psychischen Leiden jener Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt waren. Manche litten unter Schlaflosigkeit, Herzrasen, manche verweigerten die Nahrungsaufnahme und erschraken vor alltäglichen Gegenständen. Im Englischen nannte man diese Phänomene ‚bomb-shell disease‘, im deutschen Sprachraum waren solche Patienten als ‚Kriegszitterer‘ bekannt. Cannon setzte dazu in Laborexperimenten Haustiere verschiedenen bedrohlichen Situationen aus und analysierte ihre Reaktionen.
1915 publizierte er auf Grundlage seiner Beobachtungen und führte den Begriff ‚Fight or Flight Response‘ ein. In Kampf oder Flucht sah er die zwei zentralen Reaktionsweisen aller Lebewesen, einschließlich des Menschen, die in bedrohlichen Situationen das Überleben sichern sollten.
Bei Wahrnehmung einer Gefahr arbeiten Nerven- und Hormonsystem eng zusammen: Die Pupillen vergrößern sich, die Augen sind weit geöffnet, Herz- und Atemfrequenz werden gesteigert. Diese Reaktionen erfolgen direkt über das Nervensystem und wirken in Sekundenbruchteilen. Gleichzeitig wird dadurch auch das Hormonsystem aktiviert: Die Hirnanhangdrüse entlässt Hormone in den Blutkreislauf, die dann unter anderem in der Nebenniere bewirken, dass das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Dieses beschleunigt den Stoffwechsel und stellt dem Körper energiereiche Verbindungen zur Verfügung. Diese schnell verfügbaren Kraftreserven liefern die Energie für jene zwei Verhaltensmodi, die bedrohlichen Situationen angemessen sind: Kampf oder Flucht.

Cannon verwendete anfänglich noch nicht den Ausdruck Stress, dieser wurde erst Anfang der 1930er Jahre von Hans Selye, einem österreichischen Mediziner, als allgemeines Anpassungssyndrom des Organismus beschrieben, um eine traumatische, mitunter lebensgefährdende Situation zu überstehen. In dem damals vorherrschenden mechanistischen Verständnis organismischer Vorgänge waren jene diagnostizierten Symptome der heimgekehrten Soldaten daher keine Fehlfunktion, sondern eine gesunde und zweckdienliche Reaktion des Körpers.
Dieser Auffassung entsprach auch der dafür gewählte Begriff ‚Stress‘. Hans Selye übernahm das Wort aus der physikalischen Werkstoffkunde. Stress beschreibt dort die Veränderung eines Materials bei äußerer Krafteinwirkung als messbare Größe. Genauso wie bei einem Stück Metall wurden jene Kräfte beschrieben, die ein Lebewesen ‚verbiegen‘. Und – um in dieser Analogie der Mechanik zu bleiben – dementsprechend galt auch für Tier und Mensch: Wer unter der Belastung nicht zerbricht, der kann durch solche Situationen sogar ein stimulierendes Erlebnis erfahren. Selye definierte zwei verschiedene Arten von Stress: den negativen, auch Disstress genannt, und den positiven, den sogenannten Eustress. Dieses Konzept wirkt auf den ersten Blick plausibel. Wer zum Beispiel im sportlichen Wettkampf steht, durchlebt auch eine Stresssituation: Der Puls ist beschleunigt, die Nackenhaare sind nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich aufgestellt, das Schmerzempfinden ist gesenkt. Der hier als positiv gewertete Stress erhöht die Aufmerksamkeit und fördert die Leistungsfähigkeit. Doch dieselbe Situation kann von einer anderen Person als unangenehm, bedrohlich oder überfordernd empfunden werden. Wer sein Tennisracket vor Wut auf den Boden schleudert, Schimpfworte ausstößt oder vielleicht sogar seinen Gegner real attackiert, der empfindet keinen Glücksmoment.
Stress beschreibt dort die Veränderung eines Materials bei äußerer Krafteinwirkung als messbare Größe.
Und da offenbart sich die Schwäche dieser Theorie von Eu- und Disstress: Wenn jeder subjektiv für sich beurteilen kann, wo die Grenze zwischen Herausforderung und Überforderung liegt, dann hilft diese Definition weder bei der Stresserkennung noch bei der Prävention.
Obwohl, wie eingangs dargestellt, die Erforschung von Stresssymptomen durch Studien an Haustieren begonnen hat, wurden die Auswirkungen bedrohlicher Situationen auf Tiere bislang relativ wenig untersucht. Der Philosoph Will Kymlicka schrieb dazu in seinem Buch Zoopolis (Suhrkamp Verlag 2013), dass wir Tiere viel mehr als soziale Gegenüber und damit als Mitglieder unserer Gesellschaft betrachten sollten. Diese geforderte Gleichstellung von Menschen und Haustieren mag auf den ersten Blick irritieren, doch wer darüber nachdenkt, wird erkennen, dass wir Tiere seit Tausenden Jahren auch darauf hin züchten und domestizieren, dass sie mit uns kooperieren und wir uns mit ihnen zumindest auf einer einfachen Ebene verständigen können. Jeder Besitzer von Haustieren und sogenannten Nutztieren kennt entsprechende Situationen: Tiere betteln uns um Futter an, wollen unsere Aufmerksamkeit und manchmal fürchten sie sich auch. Wer aufmerksam hinsieht, wird den Stress erkennen können, der unseren Reaktionen durchaus ähnlich ist. Ein junger Hund kommt schnell in einen Alarmzustand, wenn ein anderer, fremder Hund sich ihm nähert. Er legt die Ohren an, duckt sich und bekommt weite Pupillen. Geht der andere Hund ohne Kontaktaufnahme weiter, pendelt sich das Nerven- und Hormonsystem wieder auf den Ruhezustand ein. Bleibt die durch den potenziellen Gegner ausgelöste Alarmsituation aber bestehen, dann steigt der Stresslevel weiter an. Unser junger Hund muss sich nun entscheiden, ob er flüchtet oder kämpft.
Manchmal kann man dabei auch beobachten, dass ein Konflikt zwischen diesen zwei Instinkten besteht und es zu einer ganz anderen, scheinbar unpassenden Reaktion kommt. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz prägte dafür den Begriff der Übersprungshandlung, wenn – in unserem Fall – der junge Hund nun seinen eigenen Schwanz attackiert.
Eine andere, oft zu sehende Situation für stressinduzierte Reaktionen entsteht, wenn man Hunden Befehle gibt, die für die Tiere entweder unklar oder unwillkommen sind. Zuerst reagieren die Hunde nicht auf unsere Aufforderung und bleiben scheinbar ungerührt sitzen. Das Stresssystem des Körpers beginnt aber hochzufahren. Verschärfen wir unseren Tonfall, würde ein uns fremder Hund entweder das Weite suchen (Flucht) oder uns anknurren (Kampf). Sind beide Reaktionsweisen nicht möglich, dann beginnen die Tiere sich plötzlich zu putzen oder ihr Spielzeug zu bearbeiten. Vielfach wird ein solches Verhalten falsch verstanden, wenn man glaubt, dass Hunde, die so reagieren, keinen Stress hätten. Sie suchen aber vielmehr eine Möglichkeit, auf die Alarmsituation zu reagieren und die zur Verfügung gestellte Energie abzubauen.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 90: „Achtsamkeit und Stressbewältigung"
Es legt die Ohren an, duckt sich und bekommt weite Pupillen.
Jeden Tag gibt es zahlreiche dieser Situationen bei Mensch und Tier und es stellt sich die Frage, wie viel Stress der Körper verkraften kann.
Da es bislang keine einheitliche Definition von Stress gibt und diese Belastung in vielen verschiedenen Bereichen wie bei Sport, Arbeit oder sozialen Kontakten auftritt, gibt es dafür nur eine eher allgemeine Regel: Je länger und stärker die Stressbelastungsphase war, desto länger und intensiver muss die Erholungsphase vor einer weiteren Belastung sein.
Neben den im Körper durch das Nerven- und Hormonsystem ausgelösten Stressreaktionen spielt auch das Immunsystem eine wichtige Rolle. Cortisol, das als Stresshormon im Körper ausgeschüttet wird, ist nicht nur namentlich, sondern auch chemisch eng mit Kortison verwandt. Beide Verbindungen haben eine dämpfende Wirkung auf das Immunsystem, weswegen es bei einer dauerhaft stressbedingt hohen Cortisolmenge im Blut bei Mensch und Tier zu einer eingeschränkten Funktion des Immunsystems kommt.
Die Folgen einer schwachen Immunabwehr sind häufige, manchmal sogar chronische Erkrankungen. Massentierhaltung ist ein permanenter Stresserreger und die so gehaltenen Tiere müssen daher auch ständig pharmakologisch behandelt werden. Als Konsumenten merken wir nichts davon und nur manchmal schreckt uns eine Mediennachricht über die Folgen von Antibiotika oder Hormonen in den Nahrungsmitteln auf.
Und auch dann entsteht bei uns Stress.
Fotos © Pixabay