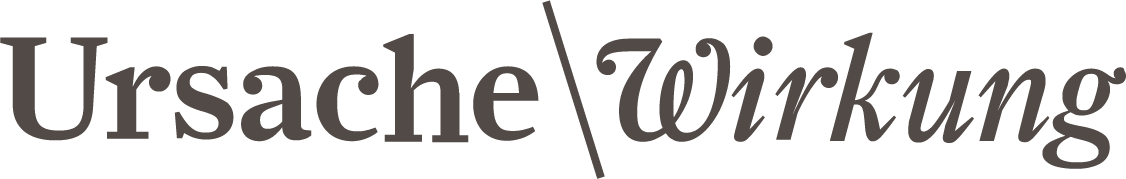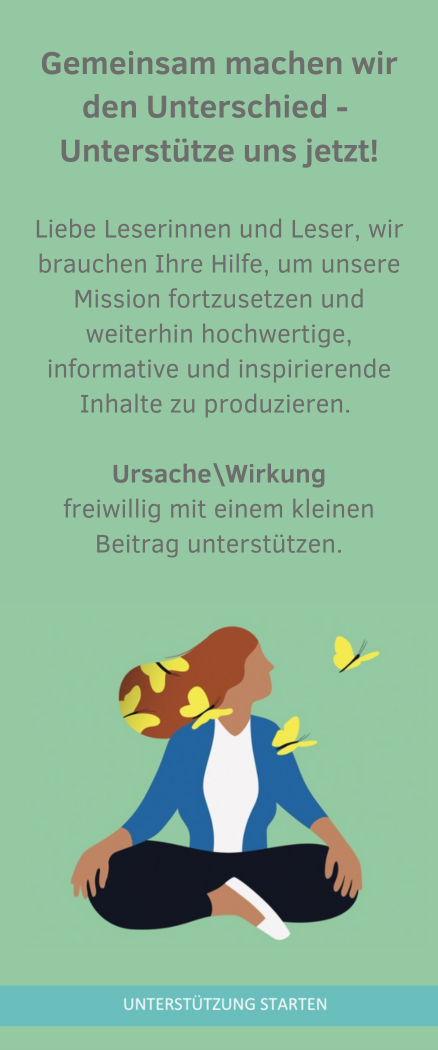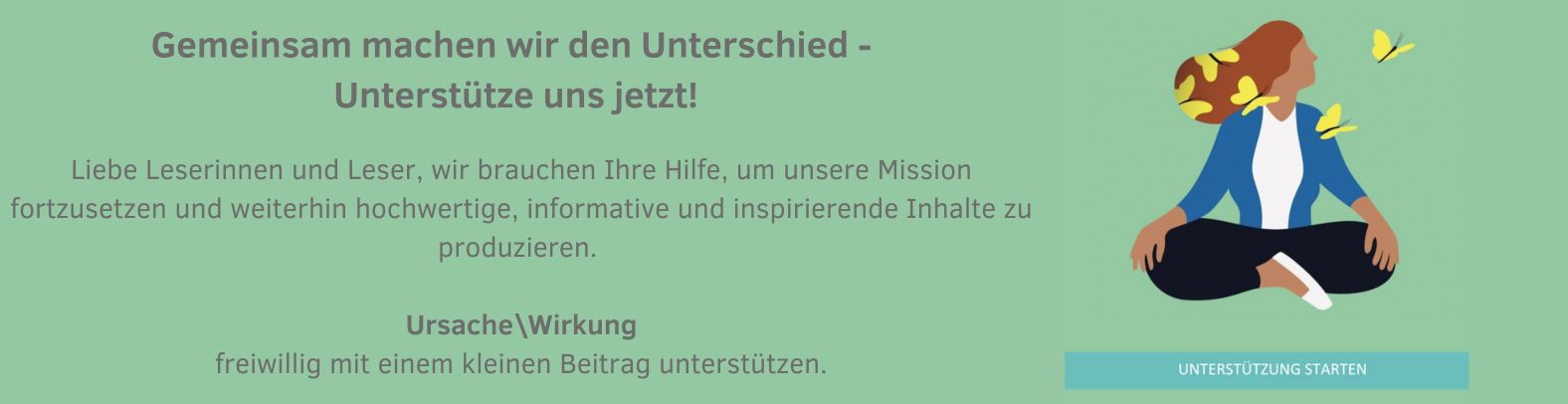Seit Jahrtausenden werden Tiere gefürchtet, vergöttert, gezüchtet und als Prestigeobjekt verwendet. Jetzt entdeckte man, dass uns Tiere nicht nur glücklich, sondern auch gesund machen können. Die Frage scheint zunächst ganz einfach zu sein: Warum halten sich Menschen Haustiere?
Die Antwort: Weil wir von Anbeginn unserer Zivilisation Nutzen aus ihnen ziehen. Hunde waren bereits während der Würm-Kaltzeit vor etwa 40.000 Jahren fixe Begleiter der menschlichen Jäger- und Sammler-Kultur. Vor circa 12.000 Jahren gelang während der sogenannten Neolithischen Revolution der Wandel zur Sesshaftigkeit noch vor der Pflanzenzucht durch die Domestikation von wilden Schafen, Rindern und Ziegen. Aber die Beziehungen des Menschen allein auf diesen Nützlichkeitsaspekt zu reduzieren wäre viel zu kurz gegriffen. Ein witzelnder Spruch deutet diese zweite, nicht minder wichtige Funktion tierischer Begleiter an: „Grundsätzlich betrachtet gibt es zwei Arten von Haustieren: Nutzhaustiere und Freudenhaustiere."
Grundsätzlich betrachtet gibt es zwei Arten von Haustieren: Nutzhaustiere und Freudenhaustiere.
In den 1990er Jahren haben Wissenschaftler in England vor Supermärkten und Volkshochschulen Passanten dazu befragt, ob diese erwägen, ein Haustier anzuschaffen oder nicht. Die durchaus umfassenden Fragebögen erhoben auch die Beziehungen dieser Menschen zu ihrem sozialen Umfeld. Die Studie kam zu dem interessanten Ergebnis, dass jene Menschen, die planten, ein Tier anzuschaffen, ihre Beziehungen zu anderen als konfliktreicher und unbeständiger beschrieben als jene Teilnehmer, die sich nicht dafür interessierten. Offenbar erleben viele Leute den Kontakt mit Haustieren als emotional bereichernd und sicherer als die oft problematischen Bindungen zu ihren Mitmenschen.
Daraus könnte man den ebenso voreiligen wie falschen Schluss ziehen, dass diese Form der Tierhaltung bloß eine Ersatzhandlung von und für Menschen mit gestörtem Sozialleben oder möglicherweise noch weitergehenden Problemen sei. Auch in der öffentlichen Meinung werden Mensch-Tier-Beziehungen von vielen Vorurteilen begleitet: Jungen Paaren, die sich eine Katze zulegen, wird gerne unterstellt, sich in Wirklichkeit ein ‚Kind mit Pelz' gekauft zu haben, Besitzer von Kampfhunden sind angeblich Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen und Reptilienhalter wollen eigentlich nur ihr eigenes farbloses Leben mit Exotik aufwerten. Und dergleichen mehr.
Würde man diesen Unterstellungen folgen, dann gäbe es für einen ‚gesunden' Menschen im Grunde keine gesellschaftlich akzeptierte Begründung, mit einem Tier zusammenzuleben. Dem gegenüber steht das Faktum, dass es weltweit in etwa 500 Millionen Haushunde und 200 Millionen Hauskatzen gibt. Für Österreich gibt es auch nur Schätzungen: In 800.000 Haushalten werden 1,5 Millionen Katzen gehalten und in etwa einer halben Million Wohnungen gibt es fast 600.000 Hunde. Dann folgt eine lange Liste anderer Kleintierarten wie Meerschweinchen (64.000), Goldhamster (30.000) und Zwerghasen (65.000). Darüber hinaus gibt es etwa 120.000 Aquarien mit vielen verschiedenen Fischen. Würde man in dieser kurzen Statistik jeden davon einzeln mitzählen, dann wären Fische eindeutig die beliebtesten Haustiere des Landes. Diese Zahlen lassen eigentlich nur einen Schluss zu: Tiere erfüllen ganz offenbar eine wichtige und stabilisierende Funktion für das Wohlbefinden der Menschen. Dieser Befund deckt sich auch sehr gut mit der offiziellen Definition der Weltgesundheitsorganisation, die Gesundheit als ‚einen Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen' beschreibt.

Tiere erfüllen ganz offenbar eine wichtige und stabilisierende Funktion für das Wohlbefinden der Menschen.
Die positive, emotional stimulierende Interaktion mit anderen Lebewesen spielt dabei eine wichtige Rolle.
Bei einer klinischen Studie zu den Folgen eines Herzinfarkts überlebten in jener Gruppe von Patienten, die ein Haustier hatten, 95 Prozent mehr als ein Jahr. In der tierlosen Vergleichsgruppe waren es nur 72 Prozent. Noch repräsentativer ist eine Langzeiterhebung aus Deutschland, welche über einen Zeitraum von fünf Jahren die Anzahl der Arztbesuche von Heimtierhaltern und Menschen ohne Kontakt zu Tieren verglich: Letztere ließen sich um 7 Prozent öfter medizinisch behandeln.
Die Neurobiologie bemüht sich deswegen zunehmend um Erklärungen für diese deutlichen psychischen und somatischen Auswirkungen von Haustieren auf Menschen jeden Alters.
Menschen sind als evolutionsbiologische ‚Rudeltiere' im Besonderen auf die soziale Resonanz ihrer Umwelt angewiesen. Vor allem in frühen Phasen der Entwicklung des Nervensystems fördern positive Zuwendung von Bezugspersonen, Lächeln, Streicheln, freundlicher Augenkontakt die Entwicklung und das Wohlbefinden. Haustiere haben im Unterschied zu Menschen eine wesentliche Eigenschaft: Sie urteilen nicht. Weder das Aussehen noch besondere Fähigkeiten oder der gesellschaftliche Status eines Menschen sind dafür ausschlaggebend, ob man von einem Tier akzeptiert wird. Bedingungslos zeigen Tiere ihre Zuneigung durch Freudensprünge, Schwanzwedeln, Entgegenlaufen oder Schnurren. Sie reagieren auf uns, sie suchen den körperlichen Kontakt, sie hören zu und freuen sich über die Gesellschaft eines Menschen.
Haustiere haben im Unterschied zu Menschen eine wesentliche Eigenschaft: Sie urteilen nicht.
Dieses Verhalten entspricht im Prinzip den Anforderungen, die an einen klientenzentriert arbeitenden Therapeuten gestellt werden: Eine Behandlung gelingt, wenn der Patient bedingungslose positive Zuwendung erfährt, ihm empathisches Verstehen entgegengebracht wird und wenn alle Äußerungen des Klienten ohne Zweifel und ohne Beurteilung akzeptiert werden.
Vor allem Tierarten wie Hunde, die selbst im Rudel leben, können sich gut in Menschen hineinfühlen. Für diese Fähigkeit zur Empathie wurden sogenannte Spiegelneuronen lokalisiert. Dabei handelt es sich um spezielle Nervenzellen, die bereits Signale aussenden, wenn eine Handlung nur beobachtet wird. Sieht man zum Beispiel, wie jemand anderer sich in den Finger schneidet, dann empfindet man selbst ein gewisses Unbehagen, gerade so, als ob man selbst betroffen wäre. Auch Hunde besitzen dieses neurologische Resonanzsystem, das sie beispielsweise zum Gähnen bringt, wenn auch wir dies tun. Diese gespiegelten Nervenimpulse bewirken in weiterer Folge die Produktion verschiedener Hormone, von denen vor allem Oxytocin, das sogenannte ‚Kuschelhormon', soziale Interaktionen verstärkt. Erhard Olbrich, Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg, der durch seine Forschungen zur Psychologie der Mensch-Tier-Beziehung bekannt wurde, nennt es ‚das endokrinologische Pendant zu Kerzenlicht, leiser Musik und einem Glas Wein'. Streichelt man sein Haustier, dann steigt bei beiden das Oxytocin-Niveau an und beide Seiten erleben das Gefühl, geliebt und akzeptiert zu werden. Unter dem Sammelausdruck ‚Green Care' werden mittlerweile alle jene Initiativen zusammengefasst, die mit Hilfe von Tieren oder Pflanzen physische, psychische, pädagogische oder soziale Verbesserungen bei bestimmten Zielgruppen bewirken möchten. Neben der Gartentherapie, für die es mittlerweile auch in Österreich an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik einen eigenen Lehrgang gibt, sind es vor allem tiergestützte Behandlungsverfahren, die bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen eingesetzt werden.
Dieser Artikel erschien in der Ursache\Wirkung №. 89: „Gesund durch Meditation"
Vor allem Tierarten wie Hunde, die selbst im Rudel leben, können sich gut in Menschen hineinfühlen.
Im deutschen Sprachraum kommen Hunde besonders in jenen Bereichen zum Einsatz, in denen keine oder nur minimale mündliche Kommunikation mit den Patienten möglich ist – wie zum Beispiel bei Sprachstörungen, Gehörlosigkeit, Autismus. Bereits weiter verbreitet ist der Besuchshundedienste in Pflege- und Altenheimen, Kindergärten oder Schulen. In Deutschland gibt es ein erfolgreich laufendes pädagogisches Programm, bei dem Tiere als sogenannte Lesehunde eingesetzt werden. Dabei liest ein Schüler dem entsprechend ausgebildeten Hund im Rahmen einer Förderstunde vor. Nicht nur die Leseleistung verbesserte sich deutlich, sondern die Anwesenheit des Hundes verbesserte die Motivation und die Emotionen der Schüler, ergab eine begleitende Evaluation. Sogar die Europäische Kommission veröffentlichte bereits 2007 den Bericht ‚Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research', in dem zu lesen war: „Es gibt überzeugende empirische Evidenz, die bestätigt, dass ein enger Kontakt mit der Natur, mit Tieren und Pflanzen, die Gesundheit und die Lebensqualität von Menschen fördert."
Das offizielle Gesundheitswesen reagiert darauf leider nur sehr zögerlich.
Bild Teaser © Unsplash
Bild Header © iStock