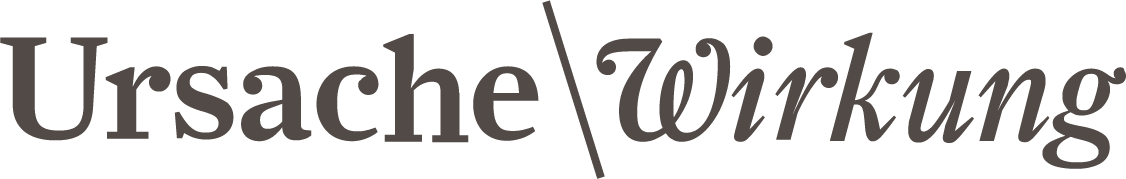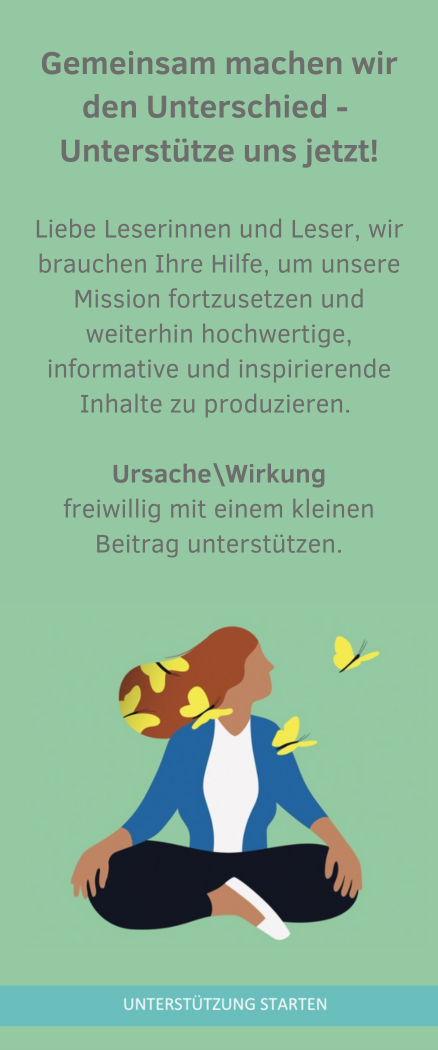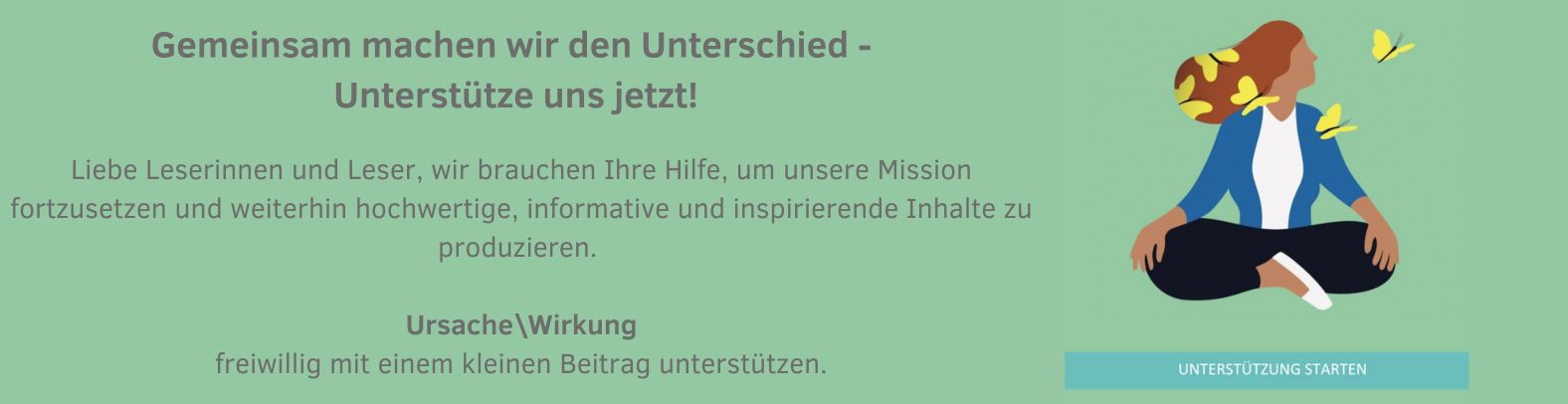Stress ist ein bewährter Reaktionsmechanismus auf mögliche Gefahrensituationen. Fatal wird es aber, wenn Tieren wie Menschen die einzigen zwei Handlungsmöglichkeiten unterbunden werden.
Der computeranimierte Film ‚Ice Age' aus dem Jahr 2002 wird von einem nervös einer Eichel nachjagenden ‚Säbelzahneichhörnchen' eröffnet. Da es diesem fiktiven Urnagetier trotz manischer Aktivität nicht gelingt, das begehrte Objekt in seinen Besitz zu bekommen, und sich ihm immer wieder neue Hindernisse in den Weg stellen, kann man die Eskalation der Stressphänomene gut beobachten: Die Pupillen erweitern sich, das Fell sträubt sich (dem entspricht beim Menschen die sogenannte Gänsehaut), durch Ausschüttung von Adrenalin werden die Reaktionen des Tierchens noch schneller, weswegen auch die Durchblutung steigen muss und damit seine Atemfrequenz.
Nachdem die jeweilige Gefahrensituation überwunden wurde, kommt es zu einem sichtbaren Erschöpfungszustand, bei dem der Körper regenerieren sollte, um das Übermaß an verbrauchter Energie zu kompensieren. Doch in diesem Film bleibt dem Nager keine Zeit dafür und er wird sofort von der nächsten kritischen Situation bedroht.
In einer Zeichentrickwelt ist das durchaus lustig, im realen Leben wäre das jedoch tödlich.

Bewusst oder unbewusst haben sich die Zeichner bei der Gestaltung von ‚Scratch', wie dieses Urzeitlebewesen genannt wird, an einem Tier orientiert, das noch immer in den Waldgebieten Südostasiens lebt und sich auch so verhält: das Tupaia, ein Tier aus der zoologischen Ordnung der Spitzhörnchen.
Dessen Vorfahren bildeten vor circa 90 Millionen Jahren eine Gruppe, aus der sich später die Primaten und damit die Menschen entwickelten.
Tupaias sind zu bevorzugten Versuchstieren für Stressforscher geworden, weil sie nicht nur leicht in Stress geraten, sondern weil man ihnen diesen durch die vielen Signale, die sie aussenden, außerdem auch noch leicht ansieht. Unter sozialem Druck richten sich ihre Schwanzhaare zur buschigen Bürste auf. Das Ausmaß und die Tagesdauer der Sträubung werden sogar zu einem ‚Schwanzsträubwert' (SST) verdichtet und als direktes Stressmaß herangezogen.
In freier Wildbahn verteidigen diese Spitzhörnchen ein mehrere tausend Quadratmeter großes Revier. Männliche Eindringlinge werden sofort attackiert und der Kampf ist meist innerhalb weniger Sekunden oder Minuten entschieden. Der Verlierer verlässt umgehend das Gebiet und kehrt dorthin auch nie mehr zurück.
Schwerwiegend sind jedoch die Folgen für das Tupaia, wenn ein Rückzug nicht möglich ist.
Der deutsche Verhaltensforscher Dietrich von Holst hat in den 1960er Jahren Tupaias in Gefangenschaft untersucht und musste dabei feststellen, dass die Tiere nicht wie andere Versuchstiere zu halten sind: Bei Anwesenheit eines fremden Artgenossen im Gehege beginnt sofort der Angriff. Der Unterlegene flieht in einen geschützten Winkel, wo er sitzen bleibt und den Sieger bei allen Bewegungen beobachtet. Wird der Verlierer hungrig, dann wagt er sich für kurze Zeit aus seiner Ecke heraus und läuft zum Futternapf. Obwohl sich der Sieger überhaupt nicht mehr für den dominierten Mitbewohner im Käfig interessiert, ist dieser nach wenigen Tagen tot. Bei der Obduktion fand von Holst zu seiner Überraschung heraus, dass der Verlierer keine Verletzungen zeigte und sein Magen auch mit ausreichend Nahrung gefüllt war. Trennte man aber den Käfigteil des Unterlegenen durch eine undurchsichtige Wand ab, dann lebte das Tierchen normal weiter. Bei Sichtkontakt durch ein Gitter hingegen starb es wie seine Vorgänger offenbar aufgrund der von ihm nicht bewältigbaren Angst. Durch die permanente sichtbare Präsenz des Siegers starben die Tiere an Harnstoffvergiftung infolge eines Nierenversagens, ausgelöst durch übermäßigen Stress.
Dieser in unserer modernen Zivilisationsgesellschaft mit ebenfalls eingeschränkten räumlichen und sozialen Fluchtmöglichkeiten populär gewordene Begriff hat aber aus evolutionsbiologischer Sicht durchaus eine wichtige Funktion. Der deutsche Biochemiker und Vordenker eines vernetzten Denkens, Frederic Vester, hat bereits 1978 in seinem populären Buch ‚Phänomen Stress – Wo liegt sein Ursprung, warum ist er lebenswichtig, wodurch ist er entartet?' diese ursprünglich sehr sinnvolle Reaktion unseres Körpers auf lebensbedrohliche Situationen beschrieben.
Unser Stammhirn – der älteste Teil unseres Gehirns – reagiert reflexartig auf jede uns plötzlich konfrontierende Situation. In Sekundenbruchteilen wird in diesem von Biologen auch ‚Reptiliengehirn' genannten Hirnteil die Entscheidung getroffen, ob wir uns einem Kampf stellen oder besser fliehen sollen. Der amerikanische Physiologe Walter Cannon prägte für diese Reaktion, die uns nur die Wahl zwischen zwei Alternativen, Flucht oder Kampf, lässt, den Begriff ‚Fight or Flight'.
Dazu ist es notwendig, dass die relativ langsame Verarbeitung des Großhirns im Einfluss zurückgedrängt wird. Das Säugetier kann dann rascher, aber auch mit größerer Fehlerquote reagieren. Die oft präzisere Einschätzung der Situation durch das Großhirn käme in einer Gefahrensituation oft lebensgefährlich langsam zustande.
Physiologisch sieht dieser Ablauf folgendermaßen aus: Die zentral im Hirn gelegene Hypophyse veranlasst das Nebennierenmark, vermehrt das Hormon Adrenalin freizusetzen. Dadurch steigen blitzartig Puls, Blutdruck und Herzfrequenz an. Körperreserven wie Glykogen, Fette und Eiweiße werden in ihre Bestandteile zerlegt und stehen zur weiteren Energiegewinnung bereit. Die Körpertemperatur steigt an, das Kühlsystem reagiert darauf beim Menschen mit Schweißausbruch, bei felltragenden Tieren mit intensiviertem Hecheln. Der Verdauungsprozess und die Sexualfunktionen werden vorübergehend ausgeschaltet.
Unabhängig davon, welche Entscheidung das Tier oder auch ein Steinzeitmensch getroffen hatte, ob für Angriff oder Flucht, in jedem Fall wurden die schlagartig bereitgestellten Energien verbraucht. Entkam man seinem Gegner oder besiegte diesen, dann hatte das Lebewesen Zeit, sich zu erholen. Plötzlich spürte es die Erschöpfung, aber auch eine Erleichterung und eine gewisse Zufriedenheit.
Ist aber, wie in dem eingangs geschilderten Beispiel der gemeinsam in einem Käfig gehaltenen Tupaias, keine Zeit oder Möglichkeit für diese wichtige Phase der Erholung, dann bleibt der energieintensive Stoffwechsel bestehen und der Körper leidet bald an Verschleißerscheinungen wie ein permanent auf Hochtouren laufender Motor.
Dieser Zustand wird im Unterschied zum motivierenden Eustress als Disstress bezeichnet, nach Ansicht Vesters ‚lediglich eine pervertierte Form des gleichen uralten Regulationsmechanismus, der Mensch und Tier über Millionen Jahre überleben ließ'.
Dies als rein menschliche Zivilisationserscheinung darzustellen, ist aber nicht ganz richtig. Auch sogenannte ‚niedere Lebewesen', wie zum Beispiel Ameisen, können unter Disstress leiden. Werden diese in einem Glaskasten gehalten, der für die Koloniegröße zu klein bemessen ist, dann bedingt dies für die Arbeiterinnen eine Einschränkung ihrer Futtersuche. In der freien Natur bedeutet ein maximales Territorium auch ein maximales Futterangebot. Scheinbar unermüdlich laufen dann die Ameisen herum und zeigen eine – oft fälschlich positiv interpretierte – hohe Aktivität, bis ihre Energiereserven erschöpft sind. Dann verharren sie unbeweglich in einer Ecke und sterben.
Der amerikanische Biologe Robert Sapolsky forschte zum Thema Stress an Steppenpavianen. Diese gleichen uns Menschen physiologisch, psychologisch und sogar in ihrem Sozialleben. Für ihre Mahlzeiten müssen sie nur drei Stunden am Tag arbeiten. Den Rest der Zeit verbringen sie damit, sich durch eine Vielzahl gezielter Feindseligkeiten bzw. Allianzen das Leben schwer zu machen. Und genau wie wir leiden Paviane vor allem unter Krankheiten, die von diesem Psychostress herrühren und weniger durch eine karge natürliche Umwelt. Interessanterweise waren jene Paviane am erfolgreichsten, gemessen an der Zahl ihrer Nachkommen und der Lebensdauer, die nicht an der Spitze der Horde standen, sondern in der zweiten Reihe der Hierarchie. Während sich die Leitbullen in einer Vielzahl von Rangordnungskämpfen aufrieben, führten die ‚Vizepräsidenten' ein stressfreieres und damit gesünderes Leben. In diesem Fall gilt wohl der Spruch: „Etwas weniger ist oftmals mehr."
Bilder © Pixabay